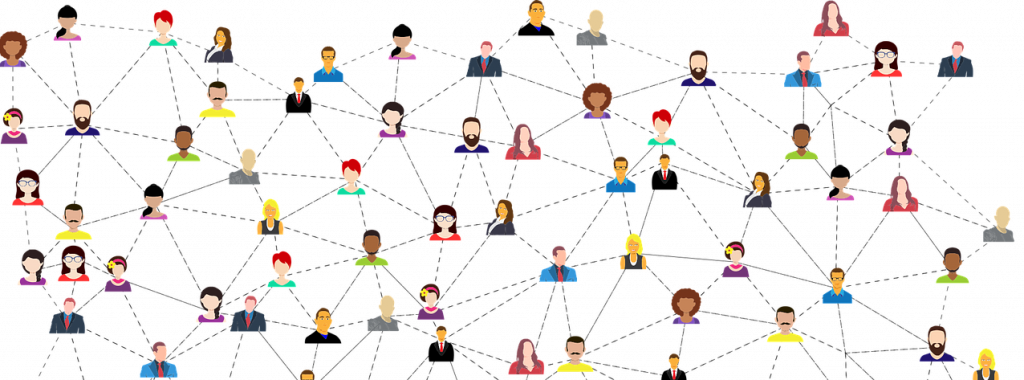In dem Artikel Richter, C. (2022): Auf dem Weg zu mehr Agilität: Ein Feld für Projekteinsätze von Beschäftigten aus Unternehmen in öffentlichen Verwaltungen. In: projektmanagementaktuell 3/2022, S. 61-67 stellt der Autor die besonderen Rahmenbedingungen öffentlicher Verwaltungen dar, die sich doch erheblich von wirtschaftlich geprägten Organisationen unterscheiden. Es wird weiterhin aufgezeigt, dass sich die öffentliche Verwaltung in einem Ineffizienzkreislauf befindet: (1) Mangelnden Effizienz in Entscheidungsprozessen > (2) Operative Hektik > (3) Vernachlässigung von Zukunftsprojekten > (4) Reaktive Kommunikation / eingeschränkte Mitgestaltung > ( 1) Mangelnde Effizienz in Entscheidungsprozessen etc. (ebd. S. 62). Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, bietet sich eine stärkere Projektorientierung an, die je nach Vorhaben plangetrieben, hybrid und/oder agil sein. kann. Denn nicht jedes Projekt ist für agile Vorgehensmodelle geeignet.
“Nicht erst die Corona-Pandemie zeigt die Notwendigkeit zur aufbau- und ablauforganisatorischen Flexibilität, um unvorhersehbare und bislang unbekannte Aufgaben erledigen zu können. Flexibles Handeln setzt das Beherrschen von Methoden des Projektmanagements voraus, sodass die Linienorganisation bei Bedarf um eine Projektorganisation ergänzt werden kann. Mit einem Projekt-Mindset lassen sich Aufgaben verstärkt interdisziplinär angehen. Damit wird zusätzlich die Umsetzung von Innovationsprozessen beschleunigt. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei dem agilen Projektmanagement zu. Im Kern meint Agilität die Erhöhung von Anpassungsfähigkeit” (ebd. S. 65).
Ein für mich positives Beispiel ist die Stadt Köln. In den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen haben sich in den letzten Jahren sehr viele Mitarbeiter der Stadt Köln zum Thema weitergebildet und entsprechende Kompetenzen entwickelt. Dabei waren alle Teilnehmer offen und der Projektarbeit positiv gegenübergestellt. Damit dieser Weg erfolgreich ist, sollten die Rahmenbedingungen für die öffentliche Verwaltung eine Projektorientierung stärker ermöglichen, damit sich ein entsprechendes Projekt-Mindset entwickeln kann. Solche Zusammenhänge berücksichtigen wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK). Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.