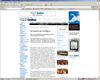 In dem Beitrag geht es um die Irrungen der Intelligenzmessung: “Alle gravierenden Einwände nützen nichts: Menschen werden mit Intelligenztests weiterhin traktiert und taxiert.” Ein lesenswerter Artikel mehr der zeigt, wie kritisch die IQ-Bewegung gesehen werden sollte. Möglicherweise zeigt die Multiple Intelligenzen Theorie in eine neue Richtung. Verschiedene Anzeichen sprechen meines Erachtens dafür. Siehe dazu die Beiträge in meinem MI-Blog.
In dem Beitrag geht es um die Irrungen der Intelligenzmessung: “Alle gravierenden Einwände nützen nichts: Menschen werden mit Intelligenztests weiterhin traktiert und taxiert.” Ein lesenswerter Artikel mehr der zeigt, wie kritisch die IQ-Bewegung gesehen werden sollte. Möglicherweise zeigt die Multiple Intelligenzen Theorie in eine neue Richtung. Verschiedene Anzeichen sprechen meines Erachtens dafür. Siehe dazu die Beiträge in meinem MI-Blog.
ConWeaver: Eine Lösung zur Wissensvernetzung?
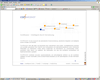 Die Ankündigung des Tools ConWeaver ist vielversprechend: “ConWeaver ist eine Lösung für die automatisierte Wissensvernetzung, semantische Integration und intelligente Suche in Portalen und Intranets.” Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin sehr für die Nutzung der neuen technologischen Möglichkeiten, möchte aber dennoch auf die Besonderheiten von Wissen eingehen. Schauen wir uns zunächst den ersten Teil des Satzes an, in dem von “automatisierter Wissensvernetzung” die Rede ist. Betrachtet man Wissen durch die Brille des Konstruktivismus´, so ist diese Aussage zu relativieren. Wenn Wissen situativ ist und in dem jeweiligen Kontext konstruiert wird, so leuchtet mir eine automatische Wissensvernetzung z. B. von impliziten Wissen mit Hilfe des Tools nicht ein. Weiterhin wird von einer “intelligenten Suche” gesprochen. Scheinbar ist heute alles intelligent: Software, Häuser, Autos, Straßenschilder usw. Intelligenz ist ein Konstrukt, das über 100 Jahre von dem IQ bestimmt war. In der Zwischenzeit gibt es Alternativen, die zwar auch heftig kritisiert werden, aber doch immer stärker auf dem Vormarsch sind (Siehe den Hinweis von Rauner 2004, der auf die Konvergenz der Kompetenz- und Intelligenzdebatte verweist). Von welcher Art “Intelligenz” wird hier in Verbindung mit dem Tool ConWeaver gesprochen? Ist es die künstliche Intelligenz (dann sollte man es auch so formulieren) oder meint man nur ein adaptives System? Und was ist mit den intelligenten Personen, die Wissen aus Daten und Informationen konstruieren, und es selbstorganisiert in Unternehmen (Domänen) so einsetzen, dass Probleme (Complex Problem Solving) des Kunden gelöst werden (Kompetenz: Selbstorganisationsdisposition)? Wie werden diese intelligenten Menschen von dem Tool unterstützt? Am Ende noch einmal der Hinweis: Ich bin für die Nutzung des Semantic Web, dennoch halte ich den Sprachgebrauch zur Zeit für etwas unglücklich.
Die Ankündigung des Tools ConWeaver ist vielversprechend: “ConWeaver ist eine Lösung für die automatisierte Wissensvernetzung, semantische Integration und intelligente Suche in Portalen und Intranets.” Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin sehr für die Nutzung der neuen technologischen Möglichkeiten, möchte aber dennoch auf die Besonderheiten von Wissen eingehen. Schauen wir uns zunächst den ersten Teil des Satzes an, in dem von “automatisierter Wissensvernetzung” die Rede ist. Betrachtet man Wissen durch die Brille des Konstruktivismus´, so ist diese Aussage zu relativieren. Wenn Wissen situativ ist und in dem jeweiligen Kontext konstruiert wird, so leuchtet mir eine automatische Wissensvernetzung z. B. von impliziten Wissen mit Hilfe des Tools nicht ein. Weiterhin wird von einer “intelligenten Suche” gesprochen. Scheinbar ist heute alles intelligent: Software, Häuser, Autos, Straßenschilder usw. Intelligenz ist ein Konstrukt, das über 100 Jahre von dem IQ bestimmt war. In der Zwischenzeit gibt es Alternativen, die zwar auch heftig kritisiert werden, aber doch immer stärker auf dem Vormarsch sind (Siehe den Hinweis von Rauner 2004, der auf die Konvergenz der Kompetenz- und Intelligenzdebatte verweist). Von welcher Art “Intelligenz” wird hier in Verbindung mit dem Tool ConWeaver gesprochen? Ist es die künstliche Intelligenz (dann sollte man es auch so formulieren) oder meint man nur ein adaptives System? Und was ist mit den intelligenten Personen, die Wissen aus Daten und Informationen konstruieren, und es selbstorganisiert in Unternehmen (Domänen) so einsetzen, dass Probleme (Complex Problem Solving) des Kunden gelöst werden (Kompetenz: Selbstorganisationsdisposition)? Wie werden diese intelligenten Menschen von dem Tool unterstützt? Am Ende noch einmal der Hinweis: Ich bin für die Nutzung des Semantic Web, dennoch halte ich den Sprachgebrauch zur Zeit für etwas unglücklich.
Was ist Web 2.0? Deutsche Übersetzung des Originalbeitrags von O´Reilly (2005)
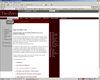 Der Originalbeitrag von O´Reilly (30.09.2005) wurde von Patrick Holz übersetzt (Deutsche Fassung). Ich hoffe sehr, dass viele sich den Artikel durchlesen, denn er bietet viele neue Erkenntnisse und regt zum Nachdenken an. In dem Artikel kommt beispielsweise immer wieder der Begriff “Intelligenz” vor. Wie Sie wissen, befasse ich mich seit Jahren mit den Thema. Hier ein kleiner Textauszug: “Das zentrale Prinzip hinter dem Erfolg der Giganten aus der Web 1.0 Ära, die überlebt haben um nun die Web 2.0 Ära anzuführen, scheint zu sein, dass sie sich die Stärke des Web zu Eigen gemacht haben, die kollektive Intelligenz zu nutzen (…)”. Es werden dann einige Beispiele genannt, die meines Erachtens nicht geeignet sind das Thema “Kollektive Intelligenz” zu verdeutlichen. Auf der selben Seite kommt auch noch der Begriff “Weisheit des Volkes” vor. Aus meiner Sicht sind das alles Marketingaktivitäten bei denen versucht wird mit einem griffigen Slogan komplexe Sachverhalte darzustellen – was allerdings misslingt. Es muss deutlich gemacht werden, was das Web 2.0 wirklich darstellt. Ist es einfach mehr Interaktion, Collaboration usw.? Ist es eine Technologie, um Daten, Informationen, Wissen oder Kompetenz besser zu transformieren? Und welche Rolle spielt dabei die Intelligenz – oder eher die Intelligenzen? Die Fragen sind aus meiner Sicht nocht nicht ganz geklärt, daher bietet sich auch ein großer Raum für Spekulationen und verwirrende Sprachvielfalt. Ich bin dennoch fest davon überzeugt, dass das Web 2.0 die schon vorhandene Dynamik und Komplexität auf dem Markt weiter erhöhen wird. Aus der Sicht von Unternehmen kommt es darauf an, diese Entwicklung nicht zu verschlafen, denn Mitarbeiter (aber auch Kunden) nutzen diese Möglichkeiten schon längst privat (Asymmetrie der Nutzung von Web 2.0-Anwendungen). Unternehmen haben meines Erachtens immer noch Vorbehalte gegenüber Web 2.0 weil sie spüren, dass es nicht nur neue Tools mit sich bringt, sondern Unternehmen damit viel stärker “von unten” beeinflusst werden (Bottom-Up). Dadurch werden Strukturen, Prozesse und Regel nicht von oben festgelegt, sondern sie bilden sich …
Der Originalbeitrag von O´Reilly (30.09.2005) wurde von Patrick Holz übersetzt (Deutsche Fassung). Ich hoffe sehr, dass viele sich den Artikel durchlesen, denn er bietet viele neue Erkenntnisse und regt zum Nachdenken an. In dem Artikel kommt beispielsweise immer wieder der Begriff “Intelligenz” vor. Wie Sie wissen, befasse ich mich seit Jahren mit den Thema. Hier ein kleiner Textauszug: “Das zentrale Prinzip hinter dem Erfolg der Giganten aus der Web 1.0 Ära, die überlebt haben um nun die Web 2.0 Ära anzuführen, scheint zu sein, dass sie sich die Stärke des Web zu Eigen gemacht haben, die kollektive Intelligenz zu nutzen (…)”. Es werden dann einige Beispiele genannt, die meines Erachtens nicht geeignet sind das Thema “Kollektive Intelligenz” zu verdeutlichen. Auf der selben Seite kommt auch noch der Begriff “Weisheit des Volkes” vor. Aus meiner Sicht sind das alles Marketingaktivitäten bei denen versucht wird mit einem griffigen Slogan komplexe Sachverhalte darzustellen – was allerdings misslingt. Es muss deutlich gemacht werden, was das Web 2.0 wirklich darstellt. Ist es einfach mehr Interaktion, Collaboration usw.? Ist es eine Technologie, um Daten, Informationen, Wissen oder Kompetenz besser zu transformieren? Und welche Rolle spielt dabei die Intelligenz – oder eher die Intelligenzen? Die Fragen sind aus meiner Sicht nocht nicht ganz geklärt, daher bietet sich auch ein großer Raum für Spekulationen und verwirrende Sprachvielfalt. Ich bin dennoch fest davon überzeugt, dass das Web 2.0 die schon vorhandene Dynamik und Komplexität auf dem Markt weiter erhöhen wird. Aus der Sicht von Unternehmen kommt es darauf an, diese Entwicklung nicht zu verschlafen, denn Mitarbeiter (aber auch Kunden) nutzen diese Möglichkeiten schon längst privat (Asymmetrie der Nutzung von Web 2.0-Anwendungen). Unternehmen haben meines Erachtens immer noch Vorbehalte gegenüber Web 2.0 weil sie spüren, dass es nicht nur neue Tools mit sich bringt, sondern Unternehmen damit viel stärker “von unten” beeinflusst werden (Bottom-Up). Dadurch werden Strukturen, Prozesse und Regel nicht von oben festgelegt, sondern sie bilden sich …
Koslowski, Stefan (2003): Howard Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen im Kontext geistige Behinderung
Dieser Beitrag würde veröffenticht in: Heilpädagogik online 02/2003, S. 45-64:
Abstract: Ähnlich dem Paradigmenwechsel innerhalb der Geistigbehindertenpädagogik – weg von einer defektorientierten Beschreibung der Normabweichungen hin zu einer Orientierung an den individuellen Möglichkeiten und an den sozialen Bedingungen – entstanden auch aus psychologischer Perspektive kompetenzorientierte Denkweisen. Während lange Zeit die Intelligenzminderung bei der Beschreibung von Menschen mit geistiger Behinderung im Vordergrund stand, wehrt sich Howard GARDNER in seinem Buch „Abschied vom IQ“ gegen die Vorstellung einer allumfassenden Intelligenz und entwickelt eine Liste von sieben (inzwischen acht) unabhängig operierenden Intelligenzen. Basierend auf diesen Überlegungen setzt sich GARDNER für eine subjektzentrierte Schule orientiert an einer pluralistischen Sicht des Verstandes ein.
Oertl, W. (2003): Physik – Abbildung und Wirklichkeit
Das Projekt ging von der Annahme Howard Gardners aus, dass Intelligenz ein multi-faktorielles Phänomen sei, das sich nicht allein in IQ-Kategorien äußert. Gerade im naturwissenschaftlichen Unterricht ist der Anteil an logisch-mathematischem Denken und Vermitteln sehr hoch, dazu sollten Alternativen angeboten werden
Rösing, I. (2004): Intelligenz und Dummheit
Ein tolles, sehr lesenswertes Buch 🙂 Rezension von Jos Schnurer
